
Immer wieder berichten Betroffene in Deutschland und anderen Ländern von rätselhaften Brummtönen, die ihnen den Schlaf rauben und sie schier in den Wahnsinn treiben, aber selbst unhörbare Frequenzen scheinen Menschen krank zu machen, wenn sie in ausreichender Stärke auftreten.
Doch was hat es damit auf sich? Ist alles nur Einbildung, ein harmloses Phänomen oder steckt mehr dahinter?
Tatsächlich fühlen sich nicht nur einzelne Betroffene durch die unangenehmen Geräusche und unbekannten Einflüsse gestört, sondern solche Phänomene betreffen in der Regel ganze Ortschaften, was bereits gegen ein rein subjektives Empfinden – also Einbildung – spricht. Zudem sind die tiefen Frequenzen auch physikalisch messbar, das Phänomen ist also real.
Die Frage ist also nur: Wer oder was ist dafür verantwortlich, ist es natürlichen oder technischen Ursprungs, und wer ist schuld daran? (Der Musik-Code: Das Geheimnis der Anlage in Berlin-Tempelhof).
Erstmals aufgetaucht ist das Brummton-Phänomen bereits in den 1950er Jahren in Großbritannien, wo in den nationalen Medien darüber berichtet wurde. 1989 tauchte dieses Phänomen dann in Taos (New Mexico) auf und wird seitdem auf Englisch als „Taos Hum“ oder „The Hum“ bezeichnet, das mindestens 2% der örtlichen Einwohner wahrgenommen haben sollen.
In Deutschland wird seit dem Jahr 2000 gelegentlich in den Medien über ähnliche Fälle berichtet. 2001 stellten aufgrund des Phänomens in Baden-Württemberg 200 Betroffene Strafanzeige gegen unbekannt wegen Körperverletzung. Es wurden mit einer Spezialausrüstung Messungen an 13 Orten durchgeführt, jedoch wurde keine gemeinsame Ursache gefunden.
Heute setzt sich der Verein zur Erforschung und Verhinderung des Brummtons für die Lösung des Problems ein.
Auch 2016 brummte es noch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart, wo 10.000 Euro für eine Messung berappt werden mussten, und mittlerweile 70 Opfer des Phänomens bekannt sind, die die tiefen Schallfrequenzen auch als Vibrationen spüren.
Prof. Detlef Krahé vom Lehrstuhl für „Nachrichtentechnik / Audiosignalverarbeitung und InCar Noise Control“ an der Universität Wuppertal hat in mehreren Wohnungen vor Ort Messungen durchgeführt, auf denen das Signal eindeutig zu erkennen ist. Angesichts dessen sind somit Versuche, das Phänomen allein mit subjektiven Empfindungen wie Tinnitus erklären zu wollen, hanebüchener Unsinn.
Weitere Schwerpunkte des Brummton-Phänomens sind z.B. in Steinhöring im Landkreis Ebersberg bei München, wo ebenfalls seit Jahren nach der Herkunft der störenden Geräusche gesucht wird, die z.B. bei Mobilfunkmasten oder Gasverdichterstationen vermutet wird.
Weitere Erklärungsansätze reichen von elektromagnetischen Feldern über Vibrationen der Erde bis hin zu militärischen Geheimprojekten und außerirdischer Strahlung, doch dazu später mehr.
Aus Hamburg wird berichtet, dass das dort bereits Jahre zuvor zu hörende Störgeräusch erneut zurückgekehrt sei, dessen Klang in den meisten Schilderungen der Brummton-Opfer mit einem LKW verglichen wird, der vor dem Haus im Standgas seinen Dieselmotor laufen lässt.
Dort habe eine 2007 von der Umweltbehörde durchgeführte Messung eine Lautstärke von 17,5 Dezibel erreicht, die somit unterhalb des Grenzwertes von 20 dB liege, weshalb das Brummen laut eines Sprechers der örtlichen Umweltbehörde „messtechnisch nicht erfassbar“ sei und somit von öffentlich-rechtlicher Seite nicht eingegriffen werden könne.
Ein Betroffener aus dem Hamburger Stadtteil Rissen vermutet in der „Welt“, dass die Quelle des Brummens in diesem Fall der neu in Betrieb genommene Teilchenbeschleuniger „Petra III“ vom „Deutschen Elektronen-Synchrotron“ (DESY) sei.
Seinen Angaben zufolge sei ein dumpfes Dröhnen zu hören, seit dieser im April hochgefahren wurde, doch hält es ein DESY-Sprecher für unwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang mit dem Brummton-Phänomen bestehe, nachdem eine Überprüfung durch eigene Experten stattgefunden habe.
Zwar seien laut Experten nur 5-10% der Menschen für die Geräusche sensibel, die aber dennoch auch nach Auffassung des Umweltamtes von Leinfelden-Echterdingen gefährlich seien, indem es erklärt: „Es geht um die Gesundheit der Leute.“
Laut Rüdiger Borgmann vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz liegen über Infraschall nur wenige fundierte Kenntnisse vor, obwohl es sich dabei um alles andere als ein seltenes Phänomen handelt: Meeresbrandungen, Wasserfälle, Donner, Lawinen, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Meteore können natürliche Quellen von unhörbar tiefen Frequenzen sein.
Eine der häufigsten natürlichen Ursachen ist jedoch der Wind, durch den bei Sturm über 135 dB im unhörbaren Bereich erreicht werden können – aber auch durch ein offenes Fenster oder Schiebedach bei einer Autofahrt.
Insbesondere in Verkehrsmitteln, unter Brücken oder Tunnels können die Pegel besonders hoch sein; weit verbreitet wird Infraschall aber auch durch Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen.
Im Gegensatz zu hörbarem Schall gibt es übrigens keine gesetzlichen Grenzwerte für Infraschall, was es erschwert, hiergegen juristisch vorzugehen, z.B. bei Problemen am Arbeitsplatz oder durch Belästigungen nahe gelegener Industriebetriebe.
Während Infraschall üblicherweise aus naheliegenden Gründen unerwünscht ist, wird er mitunter aber auch absichtlich erzeugt, z.B. beim „Sensurround“-System, das erstmals 1974 beim Spielfilm Erdbeben eingesetzt wurde und für eine so realistische Geräuschkulisse gesorgt haben soll, dass die Zuschauer in manchen Gegenden gedacht haben, dass sie zu einem echten Erdbeben gehört.
Durch den großen Schalldruck von 100-120 dB stürzten in einem Kino in den USA sogar Teile der Decke herunter, wodurch zum Glück aber niemand verletzt wurde.
Außerdem existiert das Gerücht, dass auch bei Kirchenorgeln so genannte „Demutspfeifen“ im Infraschallbereich Kirchgänger in besonders andächtige Stimmung versetzen sollen, was jedoch nicht belegbar zu sein scheint.
Beim menschlichen Körper wirken sich die tiefen Frequenzen neben dem Ohr besonders auf gasgefüllte Hohlräume wie Lunge, Nasen- und Stirnhöhlen sowie Darm aus. Obwohl eigentlich unhörbar, lassen sie sich aber dennoch vom Körper wahrnehmen, wobei der Pegel allerdings derart hoch sein muss, dass bei vergleichbaren Pegeln hörbarer Frequenzen bereits Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Gehörschäden ergriffen werden müssten.
Die genauen Auswirkungen auf den menschlichen Körper lieferten – insbesondere bei schwächeren Pegeln – kaum gesicherte Erkenntnisse, aber laut Rüdiger Borgmann sollen Werte von 160 dB die Ohren mechanisch beschädigen, während 170 dB bereits nach zehnminütiger Einwirkung tödlich seien, indem sie die Lungenbläschen zum Reißen bringen.
Zu den typischen körperlichen Reaktionen bei 140 bis 155 dB gehören Atem- und Kopfschmerzen, Abnahme des Leistungs- und Konzentrationsvermögens, allgemeine Stressreaktionen, Ohrenklingeln und –rauschen sowie Benommenheit. Kein Wunder also, dass Militärs bereits an die Entwicklung von Waffen gedacht haben, mit der sich eine künstliche „Seekrankheit“ auslösen lässt.
Tatsächlich sollen während des 2. Weltkrieges in England und Japan sowie 20 Jahre später in Frankreich so genannte „Todesposaunen“ entwickelt worden sein, mit deren Hilfe versucht wurde, Infraschall als tödliche Waffe oder zumindest als Stresskanone einzusetzen.
Eine tödliche Wirkung im Umkreis von 250 Metern setzte aber derart hohe Schallpegel voraus, dass eine solche Waffe etwa im Vergleich zur Neutronenbombe zu unpraktikabel erschien.

Abb. 52: Modell der „Todesposaune“
Dies gilt jedoch nicht für eine militärische Anlage, bei der man zwar nicht im eigentlichen Sinn von einer „Waffe“ sprechen kann, und deren Existenz in dieser Form zwar offiziell bestritten wird, deren physikalische Auswirkungen jedoch eindeutig nachgewiesen werden können und mit den technologischen Möglichkeiten einer Infraschallwaffe vergleichbar sind. …
Auszug aus dem Buch „Der Musik-Code“













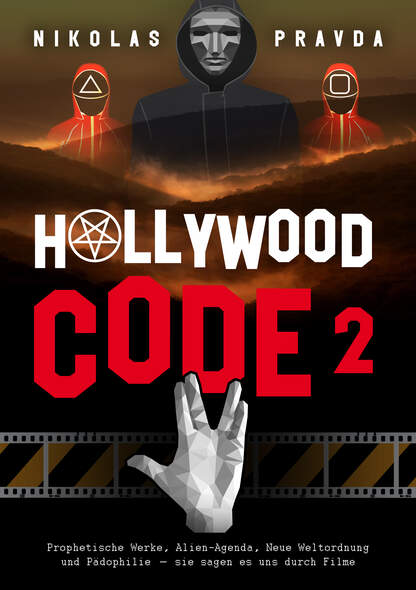
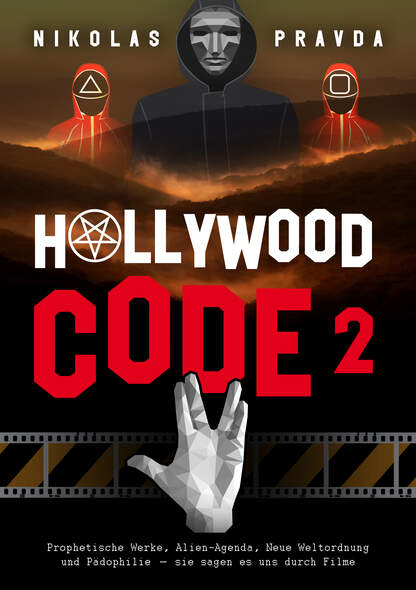
Schreibe einen Kommentar