
Die Wahrheit hinter der Maske:
Die „Shakespeare-Urheberschaftsfrage“, also das Argument, dass jemand anderes als William Shakespeare aus Stratford-upon-Avon die ihm zugeschriebenen Werke geschrieben hat, gibt es schon seit langer Zeit.
Shakespeares Urheberschaft wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts in Frage gestellt. Laut Wikipedia hat diese Kontroverse seitdem eine umfangreiche Literatur hervorgebracht und mehr als 80 Autorenkandidaten vorgeschlagen, darunter Sir Francis Bacon, Edward de Vere, 17. Earl of Oxford, Christopher Marlowe und William Stanley, 6. Earl of Derby.
Edward de Vere, 17. Earl of Oxford, war der Hauptautor der Shakespeare-Stücke. Zwischen etwa 1580 und seinem Tod 1604 schrieb er aus persönlicher Erfahrung, seiner elitären Bildung und seinem höfischen Insiderwissen.
Die Stücke waren autobiografische Kunst und dienten zugleich der Tudor-Propaganda, was de Vere angesichts seiner Position an Elisabeths Hof wahrscheinlich verstand und vielleicht sogar annahm.
Sein Leben – traumatisch, privilegiert, gelehrt und konfliktreich – lieferte den Rohstoff, den das Genie in universelle Kunst verwandelte.
Nach de Veres Tod erkannten Francis Bacon und ein Kreis von Intellektuellen, darunter Ben Jonson, das imperiale Potenzial dieser Werke.
Sie schufen den Mythos von William Shakespeare – unter dem Deckmantel der bequemen Existenz des Schauspielers und Geschäftsmanns aus Stratford – und veröffentlichten 1623 die erste Folio-Ausgabe .
Dies war nicht nur literarischer Betrug; es war Sozialtechnik im großen Stil und schuf einen nationalen Mythos, der Jahrhunderte der englischen und weltweiten Kultur prägen sollte.
Der Mythos übertraf alle Erwartungen. Die Geschichte des ungebildeten Genies aus dem ländlichen England wurde zu einem Eckpfeiler der britischen Identität und förderte das kulturelle Selbstbewusstsein, das zum Aufbau eines Imperiums beitrug.
Shakespeare wurde zum englischen Homer, doch anders als dieser war er zugleich geheimnisvoll und demokratisch – ein Niemand, der zum Dichter aller wurde.
Über Schulen, Theater und Freimaurerlogen verbreitete sich der Mythos rund um den Globus und ließ englische Denkmuster universell und selbstverständlich erscheinen.
Die Täuschung zeigt, wie Macht die Realität eines Konsenses herstellt. Bei der Shakespeare-Fälschung ging es nicht nur darum, die Identität eines Autors zu verbergen; es ging darum, einen nationalen Mythos zu schaffen, der mächtig genug war, Jahrhunderte kultureller Entwicklung zu prägen.
Heute, da wir andere „offizielle Geschichten“ – von Massenvernichtungswaffen bis hin zum Ursprung von Pandemien – hinterfragen, ist die Frage nach Shakespeares Urheberschaft ein Beweis dafür, dass unsere liebgewonnenen kulturellen Überzeugungen möglicherweise ausgeklügelte Fiktionen sind, die Interessen dienen, die wir nie vermutet hätten.
Die wahre Tragödie besteht nicht darin, dass wir über den Autor von Hamlet getäuscht wurden – sondern darin, dass man uns beigebracht hat, unerklärliche Genialität anzubeten, anstatt zu verstehen, dass große Kunst aus gelebter Erfahrung, Bildung, Leid und engagierter Arbeit entsteht.
De Veres Biografie macht die Stücke menschlich und zugänglich; der Mythos Shakespeare macht sie göttlich und unantastbar. Das eine dient der Wahrheit und dem menschlichen Verständnis; das andere der Macht und dem Imperium.
An einem weiteren Wendepunkt der Geschichte, an dem alte Imperien vergehen und neue Mächte aufsteigen, an dem Informationen selbst zum Schlachtfeld werden, bietet uns Shakespeares Täuschung Warnung und Hoffnung zugleich.
Die Warnung: Falsche Erzählungen können, einmal etabliert, die Realität jahrhundertelang prägen. Die Hoffnung: Die Wahrheit, wie lange sie auch unterdrückt wurde, kommt irgendwann ans Licht.
Die Stücke bleiben große Kunst, egal wer sie geschrieben hat. Doch die Kenntnis ihres wahren Autors ermöglicht es uns, sie so zu lesen, wie sie geschrieben wurden – als den Versuch eines Mannes, seinem Leben und seiner Zeit einen Sinn zu geben, nicht als mysteriöse Ausstrahlungen eines unmöglichen Genies.
Die Maske bröckelt. Dahinter steht nicht der Stratforder Geschäftsmann, sondern Edward de Vere, und hinter ihm Francis Bacon und die Architekten des Empire. Doch dahinter stehen die Stücke selbst – Liebeslieder an die Sprache, Spiegel der menschlichen Natur, Zeugnisse der Wahrheit, die die Macht zu verbergen sucht, die Kunst aber bewahrt.
Und genau darin liegt vielleicht die größte Ironie: Die Stücke, die dem Empire dienen sollen, dienen letztlich der Wahrheit und enthüllen durch ihre bloße Existenz die ausgeklügelte Täuschung, die nötig ist, um sie den Zwecken der Macht zu dienen.
Die Frage ist nun nicht nur, wer Shakespeare geschrieben hat, sondern was wir mit der Wahrheit anfangen, wenn wir sie erst einmal akzeptiert haben.
Werden wir weiterhin am Altar des falschen Genies zelebrieren oder werden wir die Stücke endlich als das sehen, was sie wirklich sind – das verwandelte Leiden eines brillanten, gebildeten, geplagten Mannes, dessen Biografie jede Zeile erhellt. Die Entscheidung liegt, wie die Wahrheit selbst, bei uns.
Hier gibt es den gesamten Aufsatz.
Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“












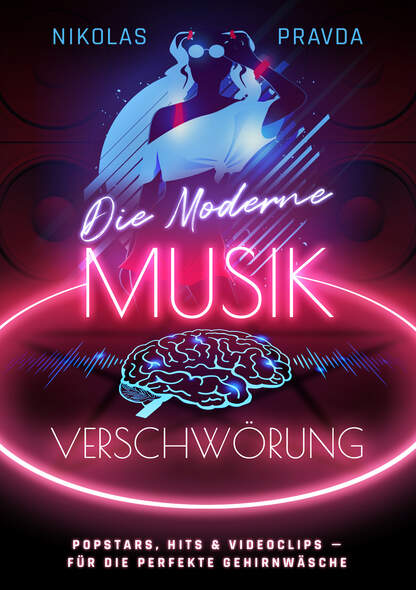

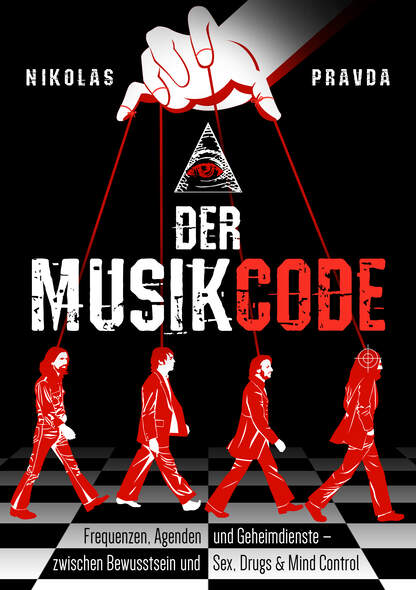
Schreibe einen Kommentar