
Von Riesenwölfen bis hin zu Wollmammuts – die Idee, ausgestorbene Arten wiederzubeleben, fasziniert die Öffentlichkeit. Colossal Biosciences, das führende Biotechnologieunternehmen aus Dallas, sorgte mit seinen ambitionierten Bemühungen, längst verschollene Tiere mithilfe modernster Gentechnik zurückzubringen, für Schlagzeilen.
Kürzlich wurde die Geburt von Welpen mit wichtigen Merkmalen des Riesenwolfs bekannt gegeben, eines ikonischen Raubtiers, das zuletzt vor über 10.000 Jahren in Nordamerika gesichtet wurde.
Dies folgte auf frühere Projektankündigungen, die sich auf das Wollhaarmammut und den Beutelwolf konzentrierten. All dies bestärkt die Überzeugung, dass die Wiederbelebung ausgestorbener Arten nicht nur möglich, sondern unmittelbar bevorstehend ist.
Doch mit dem Fortschritt der Wissenschaft bleibt eine grundlegendere Frage bestehen: Wie genau muss das Ergebnis sein, um als echte Wiederbelebung zu gelten? Wenn wir nur Fragmente des Genoms einer ausgestorbenen Kreatur wiederherstellen können – und den Rest mit modernen Ersatzstoffen rekonstruieren müssen – ist das dann wirklich Wiederbelebung ausgestorbener Arten, oder erschaffen wir lediglich Doppelgänger?
In der Öffentlichkeit weckt die Wiederbelebung ausgestorbener Arten oft Assoziationen mit einer Auferstehung im Stil von Jurassic Park: die Nachbildung eines ausgestorbenen Tieres, das in der modernen Welt wiedergeboren wird.
In wissenschaftlichen Kreisen umfasst der Begriff jedoch eine Vielzahl von Techniken: Selektionszüchtung, Klonen und zunehmend auch synthetische Biologie durch Genomeditierung. Die synthetische Biologie ist ein Forschungsgebiet, das sich mit der Neugestaltung von in der Natur vorkommenden Systemen befasst.
Wissenschaftler haben durch gezielte Zucht moderner Rinder versucht, ein Tier zu erschaffen, das dem Auerochsen, dem wilden Vorfahren der heutigen Rassen, ähnelt. Das Klonen wurde bereits eingesetzt, um den Pyrenäen-Steinbock, der im Jahr 2000 ausgestorben war, kurzzeitig wiederzubeleben. 2003 brachte ein spanisches Team ein geklontes Kalb zur Welt, doch das Tier starb wenige Minuten nach der Geburt.
Dies wird oft als erstes Beispiel für die Wiederbelebung ausgestorbener Arten angeführt. Allerdings stammte das einzige erhaltene Gewebe von einem einzigen weiblichen Tier, weshalb es nicht zur Wiederherstellung einer lebensfähigen Population hätte verwendet werden können. Die Arbeit von Colossal fällt in den Bereich der synthetischen Biologie.
Diese Ansätze unterscheiden sich in ihrer Methodik, verfolgen aber ein gemeinsames Ziel: die Wiederherstellung einer ausgestorbenen Art. In den meisten Fällen entsteht dabei keine exakte genetische Kopie der ausgestorbenen Art, sondern ein Ersatz: ein moderner Organismus, der so verändert wurde, dass er seinem Vorfahren in Funktion oder Aussehen ähnelt.
Nehmen wir das Beispiel des Wollhaarmammuts. Das Projekt von Colossal zielt darauf ab, einen kälteangepassten Asiatischen Elefanten zu züchten, der die frühere ökologische Rolle des Mammuts übernehmen kann. Doch Mammuts und Asiatische Elefanten trennten sich vor Hunderttausenden von Jahren und unterscheiden sich schätzungsweise durch 1,5 Millionen genetische Varianten.
Eine vollständige Bearbeitung all dieser Gene ist derzeit unmöglich. Stattdessen konzentrieren sich Wissenschaftler auf einige Dutzend Gene, die mit wichtigen Merkmalen wie Kälteresistenz, Fettspeicherung und Haarwachstum in Verbindung stehen.
Vergleichen wir das mit Menschen und Schimpansen. Trotz einer genetischen Ähnlichkeit von rund 98,8 % sind die Verhaltens- und Körperunterschiede zwischen den beiden enorm.
Wenn schon vergleichsweise kleine genetische Unterschiede solch große Unterschiede hervorrufen können, was können wir dann erwarten, wenn wir nur einen winzigen Bruchteil der Unterschiede zwischen zwei Arten verändern? Das ist eine hilfreiche Faustregel zur Bewertung aktueller Behauptungen.
Wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, umfasste Colossals Projekt zur Züchtung von Schreckenswölfen lediglich 20 genetische Veränderungen. Diese wurden in das Genom eines Grauwolfs eingeführt, um wichtige Merkmale des ausgestorbenen Schreckenswolfs nachzuahmen.
Die so entstandenen Tiere sehen zwar ähnlich aus, sind aber aufgrund der wenigen Veränderungen genetisch viel näher mit modernen Wölfen verwandt als mit ihrem prähistorischen Namensvetter.
Colossals Ambitionen reichen über Mammuts und Riesenwölfe hinaus. Das Unternehmen arbeitet auch an der Wiederansiedlung des Beutelwolfs (Tasmanischer Tiger), eines fleischfressenden Beuteltiers, das einst auf dem australischen Festland, in Tasmanien und Neuguinea heimisch war. Das letzte Exemplar starb 1936 im Zoo von Hobart.
Colossal nutzt einen genetischen Verwandten, die Fettschwanz-Beutelmaus – ein winziges Beuteltier – als Grundlage. Ziel ist es, das Genom der Beutelmaus so zu verändern, dass es Merkmale des Beutelwolfs (Thylacin) aufweist. Das Team entwickelt nach eigenen Angaben eine künstliche Gebärmutter, um den gentechnisch veränderten Fötus auszutragen.
Colossal hat außerdem ein Projekt zur Wiederbelebung des Dodos, eines flugunfähigen Vogels, der bis ins 17. Jahrhundert auf Mauritius lebte. Für dieses Projekt wird die Nikobarentaube, einer der nächsten lebenden Verwandten des Dodos, als Grundlage für die genetische Rekonstruktion verwendet.
In jedem Fall nutzt das Unternehmen einen unvollständigen Bauplan: uralte DNA. Anschließend verwendet es die leistungsstarke Genomeditierungsmethode CRISPR, um gezielt Unterschiede in das Genom einer eng verwandten, lebenden Art einzufügen.
Die so entstandenen Tiere mögen, falls sie geboren werden, ihren ausgestorbenen Artgenossen im Aussehen und in manchen Verhaltensweisen ähneln – sie werden jedoch nicht genetisch identisch sein. Vielmehr handelt es sich um Hybriden, Mosaike oder funktionelle Ersatztiere.
Das schmälert nicht den Wert dieser Projekte. Im Gegenteil, es ist vielleicht an der Zeit, unsere Erwartungen anzupassen. Wenn das Ziel darin besteht, ökologische Rollen wiederherzustellen und nicht ausgestorbene Genome perfekt zu rekonstruieren, dann können diese Tiere durchaus wichtige Funktionen erfüllen.
Das bedeutet aber auch, dass wir uns präzise ausdrücken müssen. Es handelt sich um synthetische Schöpfungen, nicht um echte Wiedergeburten.
Technologien zur Verhinderung des Aussterbens
Es gibt konkretere Beispiele für die Beinahe-Wiederbelebung ausgestorbener Arten – allen voran das Nördliche Breitmaulnashorn. Heute leben nur noch zwei Weibchen, und beide sind unfruchtbar.
Wissenschaftler arbeiten daran, mithilfe von konserviertem genetischem Material und Leihmüttern eng verwandter Nashornarten lebensfähige Embryonen zu erzeugen. Dieses Vorhaben umfasst Klonen und künstliche Befruchtung mit dem Ziel, eine Population wiederherzustellen, die genetisch mit der ursprünglichen identisch ist.
Anders als beim Mammut oder Beutelwolf gibt es vom Nördlichen Breitmaulnashorn noch lebende Vertreter und erhaltene Zellen. Das macht den Fall grundlegend anders – eher Naturschutzbiologie als synthetische Biologie. Er zeigt aber das Potenzial dieser Technologie, wenn sie zur Erhaltung und nicht zur Rekonstruktion eingesetzt wird.
Die Genomeditierung birgt auch das Potenzial, bedrohten Arten zu helfen, indem sie genutzt wird, um genetische Vielfalt in eine Population einzubringen, schädliche Mutationen zu eliminieren oder die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und dem Klimawandel zu stärken.
In diesem Sinne könnten die Instrumente der Wiederbelebung ausgestorbener Arten letztendlich dazu beitragen, das Aussterben von Arten zu verhindern, anstatt es rückgängig zu machen.
Wo stehen wir also nun? Vielleicht brauchen wir neue Begriffe: synthetische Ersatzarten, ökologische Analoga oder künstliche Wiederherstellungen. Diese Formulierungen mögen zwar nicht so dramatisch klingen wie „Wiederbelebung ausgestorbener Arten“, aber sie entsprechen eher der wissenschaftlichen Realität.
Schließlich kehren diese Tiere nicht von den Toten zurück – sie werden Stück für Stück aus dem, was die Vergangenheit hinterlassen hat, neu erschaffen.
Letztendlich mag es keine Rolle spielen, ob wir sie Mammuts oder Woll-Elefanten, Riesenwölfe oder Designerhunde nennen. Entscheidend ist, wie wir diese Kraft nutzen – ob wir zerstörte Ökosysteme heilen, das genetische Erbe aussterbender Arten bewahren oder einfach nur beweisen, dass wir es können.
Aber wir sollten zumindest ehrlich sein: Was wir hier erleben, ist keine Auferstehung. Es ist eine Neugestaltung.












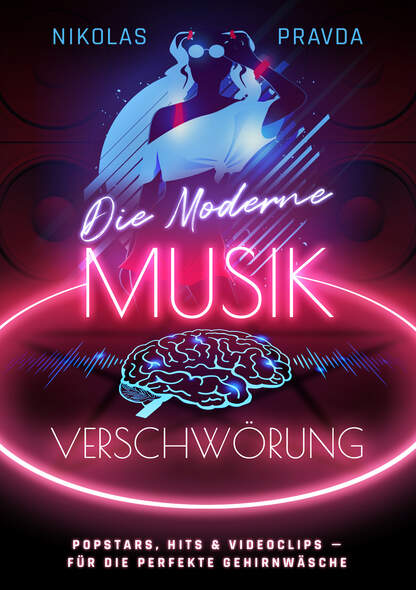

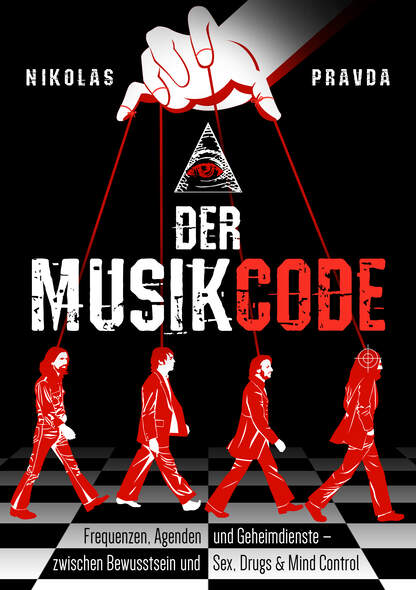
Schreibe einen Kommentar