
In vielen Heldensagen finden sich Drachenkampfszenen, wie beispielsweise jene von Siegfried/Sigurd (die aber eigentlich wohl seinem Vater Sigmund zuzuschreiben ist), Ortnit/Rentwin, Wolfdietrich, Beowulf, Thidrek von Bern und anderen.
Im Zusammenhang mit Thidrek von Bern erstaunt dabei, daß nur Wenige daran Anstoß nehmen, diesen gleichzusetzen mit Theoderich dem Großen, obwohl bei dieser verhältnismäßig jungen historischen Persönlichkeit dann auch der Drachenkampf historisch sein müßte, was aber mit Sicherheit nicht der Fall gewesen sein dürfte.
Der Einfachheit halber wird hier das Anknüpfen der Drachenepisode an Theoderich als legendenhafte spätere Ausschmückung bezeichnet, obwohl gerade dieses Argument nicht stichhaltig sein kann: Der angebliche Drachenkämpfer Theoderich prangt an einigen Kirchen (z. B. Kloster Andlau, Schwäbisch Gmünd usw.), wo er doch als schlimmster, weil arianischer Feind der Kirche gewiß nicht von ihr selbst verherrlicht worden sein kann.
Auch wenn der Drache dabei als das Böse schlechthin verstanden wird, das es zu bekämpfen gilt, kann die Kirche eigentlich nicht ihren Feind Theoderich plötzlich als willkommenen Bundesgenossen propagieren.
Und dies, obwohl doch St. Georg als eine viel bessere Alternative bereit steht. Hier paßt einiges nicht zusammen. Sobald jedoch unterstellt werden darf, es handele sich nicht um Theoderich, sondern um einen anderen Thidrek, löst sich der Feindaspekt auf zugunsten eines unverdächtigen Idealhelden, der älter ist als das Arianertum oder sogar als die Kirche selbst.
Gab es aber nun diesen früheren Thidrek, so wäre ein weiteres Mal bestätigt, daß Theoderich nur zusätzliche Staffage bildete zu einem älteren Namensträger, welcher sich jedoch wie so viele andere einfach und unverfänglich für kirchliche Zecke umformen ließ (z. B. Ostara wird zu Ostern, Mikelsberg = großer Berg wird zu St. Michaelsberg usw.).
Aber zurück zum Drachenproblem selbst, das durchaus differenziert betrachtet werden muß. Otto Höfler hat sich sehr ausführlich mit den verschiedenen Aspekten des Drachenproblems beschäftigt, bei ihm blieb die Variante „historische Drachen“ jedoch beschränkt auf das Vorkommen von Feldzeichen (Drachenstandarten usw. wie z. B. auf der Trajanssäule in Rom aus dem Jahr 113) und auf die Identifikation mit dem Reichsfeind, wobei „Reich“ bereits für ein germanisches Stammesgebiet zu verstehen ist.
Die allegorischen, kosmologischen und anderen Aspekte sollen jedoch hier nicht betrachtet werden. Drachen treten in den Sagen meistens auf unter der Bezeichnung Lindwurm und zu diesem Begriff sagt der Duden Etymologie, es handele sich eigentlich um die Verdoppelung eines Begriffes analog Damhirsch, Maultier usw. Ahd. lint bedeutet Schlange, Drache und als lint später verklang und nicht mehr verstanden wurde, verdeutlichte ein angehängtes -wurm oder -trache den veralteten Begriff (mhd. lintwurm, linttrache).
Beides meint gleichermaßen eigentlich Schlangenwurm oder Schlangendrache. Soweit Duden. Weitere historische Möglichkeiten werden weder von Otto Höfler, noch von anderen gesehen. Obwohl dem prinzipiell zugestimmt werden muß, sollten sie aber nicht ohne etwas tiefergehende Begründung bleiben und diese sollen nachstehend versucht werden.
Historisch könnte nämlich auch noch die tatsächliche Existenz eines drachenartigen Untiers wenigstens theoretisch möglich gewesen sein. Sollte ein solches auch nur ein einziges Mal Realität besessen haben, so wäre es spektakulär genug gewesen, um zum Pflichtbestandteil fast jeder Sage zu werden.
Ähnliche Beispiele publikumswirksamer Versatzstücke gibt es genügend, Snorri Sturlusson hat bekanntlich eine Art Katalog für andere Sänger zur Verfügung gestellt. Wäre ein drachenartiges Untier in frühgeschichtlicher Zeit Deutschlands oder auch später in einem Kampf mit einem Menschen geraten, so müßten ganz bestimmte Umweltbedingungen geherrscht haben.
Diese müßten es einer noch heute irgendwo anders existierenden Tierart erlaubt haben, wenigstens am Kampfplatz und seiner engeren Umgebung zu leben. Um diese Umstände zu bestimmen und nach geeigneten Örtlichkeiten suchen zu können, müssen zuerst entsprechende drachenartige Tiere betrachtet werden. Ein Überleben von Sauriern bis in die fragliche Zeit darf völlig ausgeschlossen werden.
Von heute noch lebenden Kandidaten kommen glücklicherweise kommen nur zwei Arten in Frage, so daß sich das Ganze vereinfacht.
- Krokodile. Diese leben in subtropischen und tropischen Klimaten, die eine Umgebungstemparatur von 25-30 Grad garantieren, weil sie als wechselwarme Tier bei niedrigeren Temperaturen mehr oder weniger bewegungsunfähig werden. Die generell tagaktiven Krokodile erreichen eine Länge von bis zu 6 m, sie sind an Land recht schwerfällig, im Wasser jedoch sehr beweglich. Eindrucksvoll sind ihre gewaltigen, mit Zähnen besetzten Mäuler.
-
Riesenwarane. Früher weiter verbreitet, sind sie heute nur noch auf fünf kleinen der südwestlichen Sunda-Inseln, also in tropischem Gebiet, zu finden. Die größte von diesen, Komodo, liegt zwischen Sumbawa und Flores und weist eine nur um etwa 5 Grad schwankende mittlere Jahrestemperatur von 30 Grad auf. Tagestemperaturen von teilweise über 40 Grad sind die Regel. Das Klima ist feuchtheiß, aber periodisch auch trocken. Riesenwarane werden bis zu 3 m lang, sie können sehr gut laufen, klettern, graben und schwimmen. Auch sie sind wechselwarm und unterliegen daher ähnlichen Einflüssen wie die Krokodile, sind also ebenfalls tagaktiv. Bei fallenden Temperaturen ziehen sie sich an geschützte Stellen, z. B. Höhlen zurück.
Warane züngeln ständig und erwecken ein wenig die Vorstellung von Flammenspeien, die Größe ihrer Mäuler wirkt allerdings weniger imposant, sie können aber trotzdem auch große Tiere zerreißen. Grob gesehen, müßte ein für beide Tierarten geeignetes Szenario in unseren Breiten, wo die mittlere Jahrestemperatur nur etwa 15 Grad beträgt, etwa gleich aussehen. Hierzulande schwankt dieses Temperaturmittel schon deutlich mehr, nämlich 15-20 Grad.
Daß ein geeignetes Szenario fast gar nicht oder nur selten und dann nur auf sehr engem Raum angetroffen werden kann, liegt deshalb auf der Hand, aber sehen wir weiter. In den Sagen treten die Lindwürmer stets im Zusammenhang mit Höhlen, Sümpfen oder beidem auf, also gilt es nach solchen zu suchen, die aber die entsprechenden Temperaturen garantieren können.
Dort könnten sich die Tiere stets bewegungsfähig halten und bräuchten sich nur zur Nahrungsaufnahme kurzfristig in die kältere Nachbarschaft zu begeben. Wanderungen an den angetroffenen Standort oder von diesem weg sind nicht vorstellbar und hieraus ergibt sich eine weitere Schwierigkeit, die noch erläutert werden wird.
Ausreichende Wärme für das Überleben der beiden Tierarten stellt die Natur in Deutschland nur an einigen wenigen Örtlichkeiten zur Verfügung. Diese waren zu jenen Zeiten, als die Sagen ausgelöst wurden oder sich weiter entwickelten, in geringerer Anzahl als heute bekannt, weil zwischenzeitlich neue Vorkommen erschlossen wurden. Die alten Möglichkeiten beschränken sich daher auf jene, die auch die Römer und Germanen bereits kannten und nutzten, sie werden im folgenden kurz beschrieben.
Aachen
Im Tal der Wurm (!) gelegen, sprudeln heute 30 Quellen, früher können es mehr, aber auch weniger gewesen sein. Die wärmsten von ihnen zeigen bis 74 Grad.
Baden-Baden
Die Quellen liegen am Hang und fördern bis zu 69 Grad warmes Wasser.
Badenweiler
Die am Hang liegenden, sehr starken Quellen erreichen Wassertemperaturen zwischen 28-36 Grad.
Bad Bertrich,Moseltal
Das Wasser tritt mit bis zu 32 Grad aus.
Tallage, Bad Ems
Hier erreichen die im Tal gelegenen Quellen Wassertemperaturen 27-57 Grad.
Bad Nauheim
Die gasartesischen Thermalsolequellen liegen im Tal und wurden schon seit 1000 Jahren v. Chr. zur Salzgewinnung benutzt.
Bad Schlangenbad
Der Name rührt angeblich weniger von Lindwürmern her, als von den Äskulapnattern, welche von den Römern hierher gebracht wurden. 10 Quellen mit Temperaturen von 17-30 Grad treten teils aus dem Fels, teils am Hang aus und bildeten den sogenannten warmen Bach.
Wiesbaden
Die 27 Quellen liegen in einer Talaue der umgebenden flachen Hügel und erreichen teilweise eine Temperatur von 67 Grad. Natürliche Höhlen gibt es an keinem dieser Orte, aber dafür überall Reste antiker Badbauten, die sehr wohl Höhlencharakter aufweisen können (Kanäle, Gewölbe, Hypokausten usw.).
Die in Talauen gelegenen Quellen bildeten ursprünglich sicherlich warme Sümpfe und Teiche, so daß die Szenarien der Sagen fast an allen acht Örtlichkeiten bestens erfüllt waren. Nur Baden-Baden und Badenweiler erscheinen weniger gut geeignet. Bad Nauheim wäre wegen des Salzgehaltes für Krokodile nicht geeignet.
Die restlichen sechs alten Römerbäder liegen zudem alle ungefähr innerhalb des Handlungsrahmens der Thidrekssaga, zwei von ihnen tragen sogar verdächtige Namen (Aachen an der Wurm, Schlangenbad), was aber nicht allzu hoch bewertet werden sollte. Aber damit ist erst einmal geklärt, wo es die notwendigen Bedingungen gibt, welche weitere Überlegungen gestatten.
Hierzu gehört die vielleicht entscheidende Frage, wie eine der beiden fraglichen Tierarten zur richtigen Zeit an eine dieser Örtlichkeiten gelangen konnte. Aus Gründen der nur vereinzelt vorhandenen Überlebensbedingungen sind natürliche Einwanderungen auszuschließen.
Die Tiere wären freiwillig sicher nicht in kältere Zonen vorgedrungen und ins kalte Germanien schon gar nicht. Die Ortnitsage bietet aber hierzu einen Hinweis, denn hier beschafft sich ein rachedurstiger (orientalischer?) Höfling Dracheneier und sorgt für die nötigen Temperaturen zum Ausbrüten und Überleben der Tiere. Ortnit kommt, wie vom Rächer beabsichtigt, später durch eines von ihnen ums Leben.
Eine andere Möglichkeit, die auch heute noch immer wieder Realität wird, ist das Freikommen von Tieren, die zum Zwecke der Schaustellung als Jungtiere importiert wurden. Sie können entweder von alleine entkommen oder sie werden ausgesetzt, wenn sie zu groß und gefährlich werden. In jedem Fall sind spezifische Kenntnisse über die richtige Haltung der Tiere nötig, denn schon beim Transport müssen die geschilderten Bedingungen stets eingehalten werden.
Diese Schwierigkeiten mindern die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit eines irgendwie gearteten Imports von Eiern oder Jungtieren weiter. Vollends fehlt ein archäologischer Befund und dieser steht auch kaum zu erwarten, denn Reste eines Tieres, das als Einzelexemplar existierte, sind wohl nicht mehr auffindbar, selbst wenn sie sich erhalten hätten.
Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Erhaltung liegt außerdem ebenfalls nahe Null.












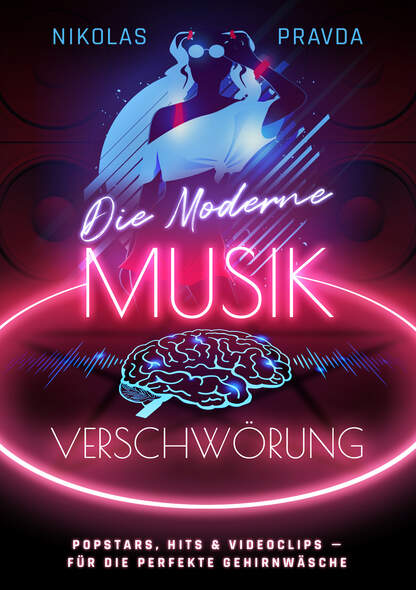

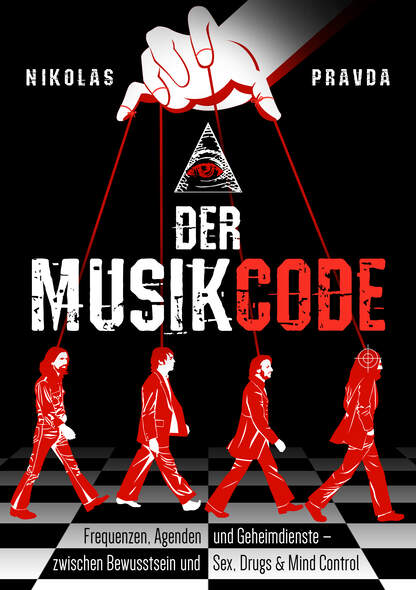
Schreibe einen Kommentar